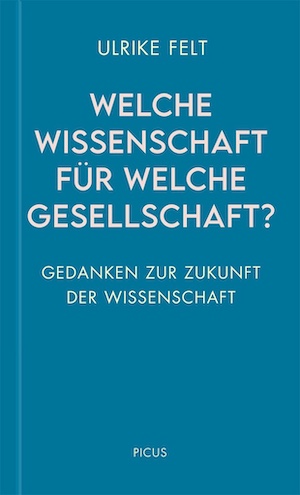 Die Wissenschaft ist offiziell ein meritokratisches System, in dem nur die besten Köpfe an die Spitze kommen. Doch empirische Daten stellen diese Annahme infrage. Faktoren wie der soziale Hintergrund, das Geschlecht und bestimmte Verhaltensweisen spielen eine erhebliche Rolle für den wissenschaftlichen Erfolg. Ulrike Felt, Leiterin des Instituts für Wissenschafts- und Technikforschung an der Universität Wien, betont, dass es nicht „die eine Wissenschaft“ oder den „einen Weg“ dorthin gibt. Vielmehr gibt es unterschiedliche Hürden, die sowohl struktureller Natur sind als auch in den gesellschaftlichen Vorstellungen und persönlichen Unsicherheiten verankert sind. Der Weg in die Wissenschaft hängt auch von den Narrativen ab, die in der Familie und der Gesellschaft über Bildung und Fähigkeiten vermittelt werden.
Die Wissenschaft ist offiziell ein meritokratisches System, in dem nur die besten Köpfe an die Spitze kommen. Doch empirische Daten stellen diese Annahme infrage. Faktoren wie der soziale Hintergrund, das Geschlecht und bestimmte Verhaltensweisen spielen eine erhebliche Rolle für den wissenschaftlichen Erfolg. Ulrike Felt, Leiterin des Instituts für Wissenschafts- und Technikforschung an der Universität Wien, betont, dass es nicht „die eine Wissenschaft“ oder den „einen Weg“ dorthin gibt. Vielmehr gibt es unterschiedliche Hürden, die sowohl struktureller Natur sind als auch in den gesellschaftlichen Vorstellungen und persönlichen Unsicherheiten verankert sind. Der Weg in die Wissenschaft hängt auch von den Narrativen ab, die in der Familie und der Gesellschaft über Bildung und Fähigkeiten vermittelt werden.
Der soziale Hintergrund ist ein entscheidender Faktor, denn Bildung ist nach wie vor ein vererbbares Gut. Obwohl der Anteil der Akademiker in der Bevölkerung wächst, ist es für Menschen aus nicht-akademischen Familien deutlich schwieriger, ein Studium zu beginnen. Im Jahr 2023 zeigte eine Studie, dass Kinder aus Akademikerhaushalten eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit haben, an einer Universität zu studieren, als solche aus nicht-akademischen Familien. Auch wenn der Zugang zur Universität heute breiter ist und mehr Studierende aus nicht-akademischen Familien kommen, bleibt die Bildungsungleichheit bestehen.
Darüber hinaus arbeiten mehr als 70 % der Studierenden neben dem Studium, oft aus finanziellen Gründen. Dies führt nicht nur zu einer Verzögerung im Studienfortschritt, sondern erhöht den ökonomischen Druck, da staatliche Unterstützungsleistungen wie Familienbeihilfe und Studienbeihilfe nach einer bestimmten Zeit auslaufen. Besonders für Studierende aus einkommensschwächeren Familien wirkt sich diese Situation negativ aus.
In Bezug auf den Frauenanteil in technischen Disziplinen gibt es nur begrenzte Fortschritte. Zwar liegt der Anteil der Frauen in den Ingenieurwissenschaften und der Informatik bei etwa einem Drittel, doch dies hängt auch damit zusammen, dass weniger Männer diese Studiengänge wählen. Das Geschlechterklischee ist auch in Österreich weiterhin stark ausgeprägt, und der Frauenanteil sinkt in höheren Karrierestufen: Während es an Universitäten anfangs relativ ausgewogen ist, nimmt der Frauenanteil nach dem Doktorat und bei Post-Doc-Stellen sowie auf Tenure-Track-Positionen kontinuierlich ab.
Ein zentraler Faktor für die ungleiche Karriereentwicklung in der Wissenschaft ist die sogenannte „Kettenvertragsregel“ im Universitätsgesetz, die die Dauer befristeter Verträge auf maximal acht Jahre begrenzt. Dies sollte eigentlich die prekäre Beschäftigungssituation der Wissenschaftler verbessern, führt jedoch dazu, dass viele gut ausgebildete Nachwuchswissenschaftler das System verlassen müssen, weil keine unbefristeten Stellen geschaffen werden.
Das Belohnungssystem in der Wissenschaft ist heute vor allem quantitativ ausgerichtet: Veröffentlichungen, Auslandserfahrung und eingeworbene Forschungsgelder sind entscheidend für die Karriere. Netzwerke und Selbstvermarktung spielen ebenfalls eine zentrale Rolle. Dieses System übersieht jedoch viele talentierte Wissenschaftler, da nicht jeder sich dem Druck des Selbstmarketings unterziehen möchte. Man sollte daher das Belohnungssystem erweitern und neben den klassischen Kriterien auch Kreativität, gute Lehre und den Mut, neue Wege zu gehen, stärker würdigen. Ein vielseitigeres System würde dazu beitragen, dass mehr fähige Köpfe im Wettbewerb bestehen können.